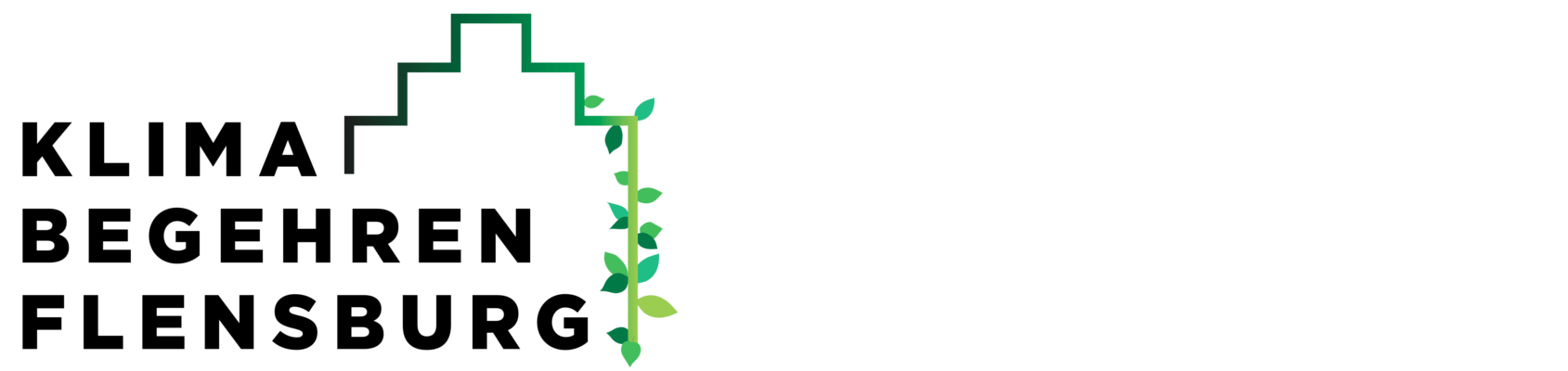Monitoring
Auf dieser Seite dokumentieren wir, wie weit die Stadtwerke mit der Umsetzung der Transformation sind.
Im Arbeitskreis Transformation haben wir gemeinsam mit den Stadtwerken und der Stadt Flensburg einen detaillierten Maßnahmenplan für die Transformation erarbeitet. In diesem sind die verschiedenen Schritte und nötigen Investitionen abgebildet, die für die Umstellung der Wärmeversorgung notwendig sind. In sogenannten „Wenn-Dann-Beziehungen“ haben wir außerdem festgelegt, welche externen Bedingungen nötig sind, damit die Stadtwerke diese Maßnahmen bis 2035 einleiten können. Nun geht es also darum, diese Maßnahmen zügig und kontinuierlich umzusetzen. Im Arbeitskreis haben wir außerdem vereinbart, dass ein Expert*innengremium aus Wissenschaft und Praxis jährlich den Fortschritt des Transformationsprozesses überprüft. Nachzulesen ist unsere Abmachung im Zwischenbericht des AK Transformation:
Zeitpfad und Emissionseinsparungen
In der Grafik ist die Reihenfolge der zu treffenden Maßnahmen festgehalten. Im Jahr 2019 haben die Stadtwerke noch ca. 565.000 Tonnen CO2 pro Jahr (t/a) ausgestoßen. Diese Emissionen müssen bis 2035 auf Null gesenkt werden. Bei den Maßnahmen steht daher dabei, wie viele Tonnen CO2 sie pro Jahr einsparen:

Die nächsten Schritte
Im Folgenden sind die einzelnen Maßnahmen aus dem Transformationsplan und ihr aktueller Status aufgelistet. Rot markierte Maßnahmen sind noch nicht gestartet worden, gelb markierte Maßnahmen befinden sich aktuell in Planung und grün markierte Maßnahmen sind bereits abgeschlossen. Grau markierte Maßnahmen wurden gestrichen oder ersetzt. Klicke auf die jeweilige Maßnahme, um mehr über den aktuellen Stand zu erfahren.
Voraussetzungen
Gründung eines Expert*innenbeirats (2023)
Das Expert*innengremium soll die Stadtwerke Flensburg beraten und einmal pro Jahr den Fortschritt der Transformation beurteilen. Zusätzlich sollen alle fünf Jahre die rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprüft werden.
Im Dezember 2023 haben die Stadtwerke die Mitglieder des Expert*innenrats bekannt gemacht. Die Mitglieder sind: Michael Kohnagel (FAB), Jürgen Möller (SBV), Till Fuder (Stadt Flensburg, Sachgebiet Klimaschutz und Klimaanpassung), Prof. Dr. Pao-Yu Oei (Europa- Universität Flensburg), Prof. Dr. Ing. Dirk Volta (Hochschule Flensburg), Karsten Müller-Janßen (Stadtwerke Flensburg), Peer Holdensen (Stadtwerke Flensburg) und Erik Brauer (IB.SH). Lars Waldmann (ew-con und Gemeinwohl) wird als neutraler Moderator fungieren.
Wir freuen uns darüber, dass der Expert*innenrat nun endlich besteht, möchten aber betonen, dass wir uns eine geschlechtergerechte Besetzung gewünscht hätten.
Update März 2024:
Am 17.01.2024 hat das Expertengremium erstmalig getag (siehe Link). Aus Kreisen des Expertenrates wurden Stimmen laut, die erstens die Zusammensetzung des Gremiums kritisierten – es sind ausschließlich Männer – und zweitens häufigere Sitzungen eines kleineren Expertenkreises zur detaillierten Diskussion strittiger Punkte verlangten.
Update November 2024:
Mit Jördes Wüstermann (Klimaschutzmanagerin der Stadt Flensburg) ist nun zumindest eine nicht-männliche Person im Gremium repräsentiert. Der Expert*innenrat hat verlangt, dass ein Plan B ohne Wasserstoff gemacht wird, da die Versorgung mit Wasserstoff sehr ungewiss und teuer ist. Es wird daher noch einmal geprüft, ob Geothermie eine zusätzliche Option in Flensburg ist.
BEW-Antrag (2023)
Die Stadtwerke bekommen für die Transformation des Wärmesystems voraussichtlich Gelder vom Staat. Die "Bundesförderung für effiziente Wärmenetze" (BEW) übernimmt bis zu 40 % der Investitionskosten und fördert noch vor Beginn der Umsetzung die Erstellung von Transformationsplänen. Bis Ende 2023 müssen die Stadtwerke dafür den gemeinsam mit uns geschriebenen Zwischenbericht zu einem detaillierten Förderantrag ausarbeiten. Voraussichtlich soll eine Zusammenfassung des Berichts auch veröffentlicht werden.
Update November 2023: Aktuell ist diese Zusammenfassung im Ratsinformationssystem der Stadt Flensburg zu finden. Die Stadtwerke haben den Förderantrag beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingereicht.
Update November 2024: Die Förderung für die Erstellung des Transformationsplans ist bewilligt und bereits ausgezahlt. Auch die Förderung für „Modul 2“ ist bereits bewilligt, die für die erste Großwärmepumpe und technologische Anpassungsmaßnahmen genutzt wird. Die im Fördermodul 4 angekündigte Betriebskostenförderung (z.B. für grünen Strom für den Betrieb der GWPs) ist beantragt und die Genehmigung wird in 2025 erwartet.
Maßnahmen
4 Wärmepumpen (2022-2029)
Insgesamt vier Großwärmepumpen (GWP) sind im Zwischenbericht des AK Transformation vorgesehen. Sie sollen durch ihre Leistung gemeinsam mehr als die Hälfte der Emissionen einsparen und die Grundlast der Wärmeversorgung übernehmen. Damit werden die Wärmepumpen die großen Kohle- und Gaskessel ersetzen. Die Inbetriebnahme der ersten Wärmepumpe ist eigentlich für das Jahr 2025 angesetzt. Statt zwei kleineren Wärmepumpen planen die Stadtwerke nun aber mit einer größeren Wärmepumpe, die eine Leistung von 55-60 MW haben soll und daher erst 2026 in Betrieb gehen kann. Eine zweite Wärmepumpe könnte dann 2027 folgen. Für uns ist vor allem wichtig, dass die Ziele zur Emissionsreduzierung (50% bis 2028) eingehalten werden.
Hier geht's zum Beispiel einer Flusswärmepumpe in Mannheim.
Update: Die Stadtwerke haben laut der SHZ außerdem das Potential von Geothermie für die Flensburger Wärmeversorgung geprüft. Die Zusammenarbeit mit der Firma wurde einige Monate später aufgrund des zu geringen Potentials jedoch wieder beendet.
Update: In ihrer Zusammenfassung des BEW-Antrags sprechen die Stadtwerke von zwei großen Wärmepumpen mit einer Leistung von 60 MW, die so schnell wie möglich in Betrieb gehen sollen. Außerdem ist eine kleinere Wärmepumpe am Klärwerk eine Option.
Update März 2024:
Die Inbetriebnahme der ersten Großwärmepumpe mit 60 MW soll jetzt erst in 2027 erfolgen. Es wurde ein Planungsbüro beauftragt, die technische Detaillierung zu erstellen. Ein Ergebnis wird noch 2024 erwartet, damit die Bauaufträge vergeben werden können. Außerdem wird bald darüber entschieden, welches Kältemittel in den Wärmepumpen eingesetzt werden soll. Wir fordern natürlich eine möglichst umweltverträgliche Variante. In diesem Dokument der Deutschen Umwelthilfe gibt es einen guten Überblick über die verschiedenen Optionen.
Update November 2025:
Gute Nachricht: Die Ausschreibung für die erste GWP läuft, Auftragsvergabe wird Anfang 2025 sein. Alle Lieferanten, die sich beworben haben, passen in den Plan. Deshalb nach aktuellem Stand: Inbetriebnahme 2027 steht - das ist unser Erfolg! Die GWP wird auf dem Gelände des Heizkraftwerks gebaut werden. Das Maschinenhaus ist bereits geplant, es muss noch den konkreten Maßen der GWP angepasst werden. Alle Lieferanten signalisieren, dass ihre GWP auch mehr als 95°C erzeugen können – was bedeutet, dass der Bedarf an Zusatzheizung mit Wasserstoff o.ä. im Winter sinkt.
Außerdem: Die angedachte GWP an der Kläranlage, die das Neubaugebiet Hafen Ost versorgen sollte, wird auch dann gebaut, wenn Hafen Ost nicht kommt, muss dann aber andere Gebiete versorgen. Dafür muss umgeplant werden, was nicht ganz leicht ist (im Maßnahmenpaket 2 für den Zeitraum 2028 bis 2031).
Temperaturreduzierung (2023-2029)
Damit die Leistung der Großwärmepumpen ausreicht, um alle Haushalte mit ausreichend Wärme zu versorgen, muss das Fernwärmenetz effizienter werden. Auf dem Weg vom Kraftwerk bis zu den Häusern geht viel Wärme verloren, deswegen ist eine Absenkung der Temperatur sinnvoll. Die Maßnahmen zur Reduzierung der Fernwärmetemperaturen werden kurzfristig begonnen und werden sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Es finden gegenwärtig detaillierte Analysen statt, in welchen Bereichen des Fernwärmenetzes zukünftig mit niedrigeren Temperaturen (70 Grad statt 95) gearbeitet werden kann.
Update März 2024: Die Stadtwerke planen, ab 2025 die Ablesung der Fernwärme-Verbräuche zu digitalisieren. Der Umstellungsprozess hat hohe Priorität, denn die Stadtwerke können dann die Wärmeproduktion genauer an die Verbräuche anpassen und somit die Wärmeverluste reduzieren.
Update November 2024:
Die Anpassung des Fernwärmenetzes an niedrigere Vorlauftemperatur, also höheren Volumenstrom und Druck, ist in Gang. Deshalb wird am Rohrnetz viel gebaut.
Biomasseverbrennung / Elektrodenheizkessel (2026-2031)
In den Wintermonaten wird es erforderlich sein, die Leistung der Wärmepumpen zu ergänzen, um die nötige Wassermenge mit der notwendigen Temperatur im Fernwärmenetz zu erreichen. Das genaue Temperaturniveau wird abhängig sein von den Technologieentscheidungen bei den Wärmepumpen und den Effekten der Maßnahme „Temperaturabsenkung“. Grundsätzlich kommen aus heutiger Sicht für diese Funktion die Nutzung von Biomasse (Holz, Biogas, etc.) oder weitere "Heißwasserelektrodenheizkessel" in Frage. Im Jahr 2026 soll die Maßnahme bewertet werden.
Update März 2024:
Die Stadtwerke bauen zur Zeit einen zweiten Elektrodenheizkessel (ein erster besteht bereits). Die Inbetriebnahme soll 2025 erfolgen.
Solarthermie und Photovoltaik (2025-2032)
Solarthermischen Anlagen wandeln Sonnenlicht direkt in Wärme um und speisen diese in das Fernwärmenetz ein. Das Potenzial in Flensburg ist aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit jedoch eingeschränkt. Deshalb wird vermutlich durch eine solarthermische Anlage nur ein sehr kleiner Teil (ca. 5000 t/a) der Emissionen eingespart werden können. Das Potenzial der Maßnahme soll im Jahr 2025 bewertet werden.
Photovoltaik erzeugt ebenso wie Windanlagen grünen Strom, der für den Betrieb der Großwärmepumpen erforderlich ist. Deshalb wird gegenwärtig diskutiert, wie ein „X000-Dächer-Programm“ für Flensburg umgesetzt werden kann, damit ab 2030 ca. 50 MWpeak grüner Strom hier vor Ort produziert wird. Wir sind zu diesem Thema im kontinuierlichen Austausch mit dem Klimamanagment der Stadt Flensburg und setzen uns dafür ein, dass bald möglichst viele freie Flächen mit Solaranlagen belegt werden können.
Update: In ihrer Zusammenfassung des BEW-Antrags sprechen die Stadtwerke von einer möglichen Solarthermieanlage mit einer Leistung von 7,6 MW für Flensburg-Weiche.
Aufbau einer lokalen, grünen Wasserstoffproduktion (2027-2035)
Wasserstoff wird in der Wärmegewinnung nur eine sehr kleine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz wird er voraussichtlich benötigt, um an sehr kalten Tagen die Sicherheit der Fernwärmeversorgung zu gewährleisten. Durch die Verbrennung können Wasser-Temperaturen erreicht werden, die mit Wärmepumpen nur schlecht abgedeckt werden können. Grundsätzlich wird jedoch auch grüner Wasserstoff als der "Champagner" unter den erneuerbaren Energien bezeichnet, da seine Herstellung sehr teuer ist (verbraucht viel grünen Strom). Er wird daher auch in den 2030er Jahren noch ein sehr knappes Gut darstellen. Am besten können wir diesem Problem begegnen, indem wir in Flensburg eine eigene Wasserstoffproduktion aufbauen. Dies geschieht normalerweise mit einem sogenannten "Elektrolyseur". Bei der Wasserstoff-Produktion entsteht neben Sauerstoff auch eine große Menge Wärme, die bei der Fernwärmeproduktion sinnvoll genutzt werden kann. Im Jahr 2027 soll erstmals bewertet werden, ob und wie eine lokale, grüne Wasserstoffproduktion möglich ist. Ab dem Jahr 2033 ist eine (Mit-)Verbrennung dieses Wasserstoffs in geringen Mengen bei der Erzeugung der Wärme-Spitzenlast vorgesehen.
Update: Im November 2023 haben die Stadtwerke angekündigt, ab 2028 in geringen Mengen grünen Wasserstoff aus Esbjerg (Dänemark) in ihren Gaskesseln mitzuverbrennen.
Saisonaler Wärmespeicher (2025-2030)
Ein saisonaler Wärmespeicher kann Energie, wie der Name schon sagt, über ganze Monate hinweg speichern. Damit hilft er dabei, ein wichtiges Problem in der Wärmebereitstellung zu lösen: Wärme wird vor allem im Winter benötigt, erneuerbarer Strom aber vor allem im Sommer durch Solaranlagen produziert. Mit einem saisonalen Wärmespeicher kann in warmen Wochen Energie aufgenommen werden und in der kalten Jahreszeit wieder abgegeben werden. Ein solcher Speicher liegt meist unter der Erde oder enthält eine große Menge Wasser, sodass Energie über lange Zeit hinweg gehalten werden kann. 2025 soll diese Maßnahme laut Transformationsplan eigentlich erstmals bewertet werden.
Update: 2023 gab es Gespräche mit Expert*innen und den Stadtwerken über einen sogenannten Aquiferspeicher. Aktuell gibt es hier keine positiven Ergebnisse.
Update März 2024: Es gibt gegenwärtig kein belastbares Konzept der Stadtwerke, das den wirtschaftlichen Anforderungen genüge leistet. Wir fordern, dass im Expertengremium dieses Thema intensiv beraten wird, da ohne saisonale Wärmespeicher die ganzjährige Produktion von emissionsfreier Fernwärme deutlich teurer wird. Das müssten die Bürger*innen über Preiserhöhungen tragen.
Update November 2024:
Der Bau eines saisonalen Wärmespeichers wird noch immer als nicht wirtschaftlich bezeichnet. Úm Stromausfälle und Strompreisspitzen abpuffern zu können, denken die Stadtwerke außerdem über die Erreichtung von Batteriespeichern nach.
Verbrauchsreduzierung und dezentrale Einspeiser (2023-2035)
Damit die Umstellung des Fernwärmesystems funktionert, müssen wir in der Stadt unseren Wärmebedarf senken. Die Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung und zur Nutzung von Wärme aus dezentralen Einspeisern werden laut Stadtwerken kurzfristig begonnen und sich über einen langen Zeitraum erstrecken. Dezentrale Einspeisung bedeutet hier, dass dem Fernwärmenetz Abwärme aus z. B. Industrieprozessen zugeleitet werden. So wird möglichst wenige Energie verschwendet. Maßnahmen zur Verbrauchsreduzierung liegen außerdem vor allem in der Hand der Stadtverwaltung. Hier heißt es: Sanieren, sanieren, sanieren, damit unsere Häuser ihren Wärmebedarf senken.
Das Thema Sanierung haben wir in einem ersten Gespräch mit der Stadt und den Stadtwerken angesprochen. Wir fordern eine großangelegte Sanierungsinitiative in Flensburg. Dafür könnten auch die Flensburger Wohnungsbaugesellschaften wichtig werden.
Umstellung der Reserveheizkraftwerke (2033-2035)
Die letzte Maßnahme aus dem Transformationsplan betrifft die Reserveheizkraftwerke der Flensburger Stadtwerke. Diese werden momentan nur im Notfall in Betrieb genommen, wenn das zentrale Kraftwerk am Hafen nicht genügend Leistung bringen kann. In Zukunft müssen auch diese Kraftwerke auf biogene Brennstoffe umsteigen, oder durch Elektrodenheizkessel ersetzt werden, sollten die bisherigen Maßnahmen nicht für die Versorgungssicherheit ausreichen. Ob und wie die Reservekraftwerke ersetzt werden müssen, wird erst 2033 entschieden.
Kommunale Wärmeplanung der Stadt Flensburg
Die Stadt Flensburg hat auf Basis der Landesgesetzgebung eine Wärmeplanung erarbeitet. Dieser Wärmeplan ergänzt den Transformationsplan der Stadtwerke um weitere Puzzlestücke. Enthalten ist z. B. die Einführung eines runden Tisches „Gebäudesanierung“ und Maßnahmen zur Absenkung der Vorlauftemperatur im Fernwärmenetz. Der Wärmeplan ist hier abrufbar:
UNSER ZIEL
Wir kippen die teure veraltete und fossile Energieversorgung und fordern nachhaltige Lösungen – und zwar jetzt.
Unsere Vision von einer nachhaltigen Energiegewinnung kannst du hier nachlesen:

Bündnis Klimabegehren Flensburg
c/o Greenpeace Flensburg
Burgplatz 1
24939 Flensburg
Schreib uns eine Mail!
Wir verwenden auf unserer Website keine Cookies.
Die Website nutzt erneuerbare Energien. Jeder Besuch verbraucht vergleichsweise wenig CO2.